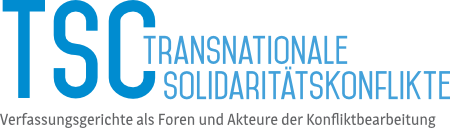Verfassungsgerichte und transnationale Solidaritätskonflikte
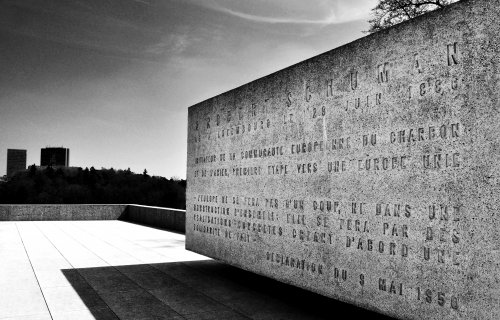
Konflikte und ihre Bearbeitung
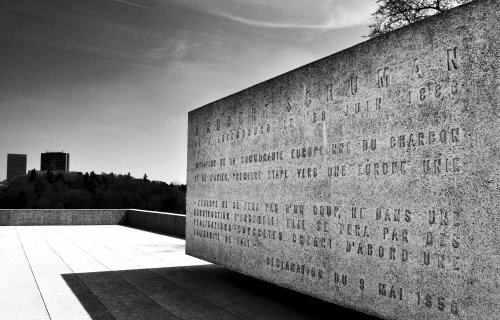
Forschungsgegenstände
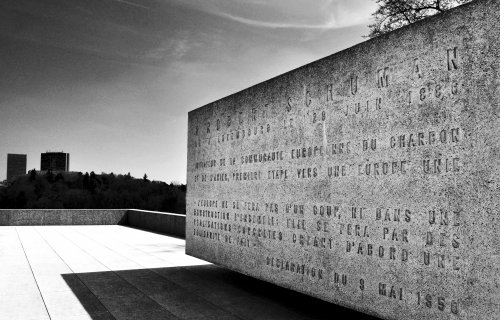
Forschungsziele
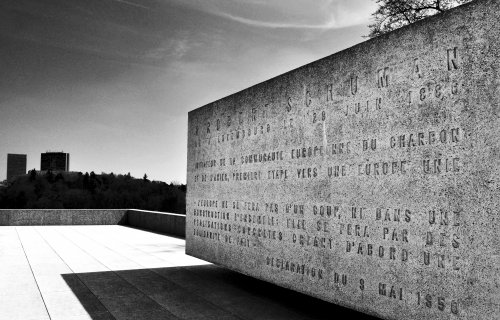
Affiliation
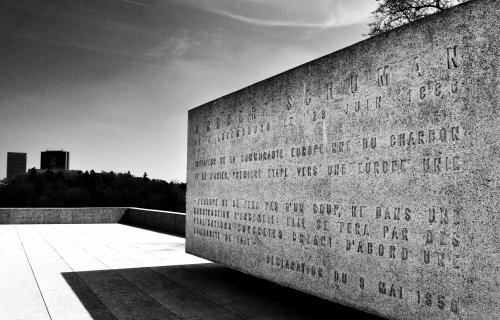
Dr. Marius Hildebrand
Dr. Marius Hildebrand ist Habilitand an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe "Transnationale Solidaritätskonflikte" an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Marius Hildebrand hat in Dresden, Granada und Freiburg Politikwissenschaft, Romanistik und Geographie studiert und 2016 mit einer hegemonietheoretischen Arbeit über Euroskeptizismus und Rechtspopulismus in der Schweiz an der Universität Hamburg in Soziologie promoviert. Im Anschluss war er als Gastwissenschaftler am Sonderforschungsbereich 138 "Dynamiken der Sicherheit. Formen der Versicherheitlichung in historischer Perspektive" an den beiden Universitäten Marburg und Gießen. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Allgemeine Soziologie, Politische Theorie, Demokratie-, Konflikt- und Diskurstheorien. Ausgehend vom Forschungsprojekt beschäftigt er sich in seiner Habilitation mit der Wahrnehmung von Verfassungsgerichten sowie mit der symbolischen Dimension von Verfassung im Kontext der Europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise.
Kontakt: marius.hildebrand[@]fau.de
Ausgewählte Publikationen:
-
Politisierung des Wissens. Gesellschaftliche Grundlagen und politische Folgen von Wissenskonflikten in polarisierten Welten. Eine Einführung, in: DGS (Hg.) Verhandlungsband des 41. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 2023 (mit Sebastian Büttner und Thomas Laux).
-
Unravelling the Politicisation-Depoliticisation Nexus of Decontestatory Politics During the Euro-Crisis, in Farahat, Anuscheh und Arzoz, Xabier (Hrsg.): Contesting Austerity. A Socio-Legal Inquiry, 2021, Oxford: Hart, S. 56-78.
-
Demokratie für Deutschland, Austerität für Europa? Grenzen der Solidarität im der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in WSI-Mitteilungen, 05/2020, S. 368-367 (mit Anuscheh Farahat).
- Populistische Kontestation als nationalkonservative Anti-Politik. Die SVP und die Hegemonisierung des Schweizer Sonderfalls, in: Kim, Seongcheol/Agridopoulos, Aristotelis (Hg.): Populismus, Diskurs, Staat, Baden-Baden, 2020, S. 191-211.
- ‘One heart for another nation’. Linke Intellektuelle beobachten die Konjunktur ethno-populistischer Politisierungen als Kehrseite neoliberalen Regierens und entdecken die Nation für sich‘, in: Soziologische Revue, 42, 3(2019), S. 418-439.
- Emanzipation und Demokratie jenseits der Aporien eines anti-soziologischen Egalitarismus. Ernesto Laclaus politische Ontologie als Antwort auf Jacques Rancières Soziologiekritik, in: T. Linpinsel /I. Lim, (Hg.), Gleichheit, Politik und Polizei: Jacques Rancière und die Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2018, S. 9-29.
- Post-foundationalism and the Possibility of Critique: Comparing Laclau and Mouffe, in: Marttila, Thomas (Hg.), Discourse, Culture and Organization: Inquiries into Relational Structures of Power, Basingstoke, 2018, S. 323-342. (mit Astrid Séville).
- Rechtspopulismus und Hegemonie. Der Aufstieg der SVP und die diskursive Transformation der politischen Schweiz, Bielefeld, 2017.
- Populismus oder agonale Demokratie. Bruchlinien der theoretischen Symbiose von Laclau und Mouffe, Politische Vierteljahresschrift, 56/1, 2015, S. 27–43 (mit Astrid Séville).
- The Negation of Power. From Structuration Theory to the Third Way, Distinktion – Scandinavian Journal of Social Theory, 13/2, 2012, S. 187–207 (mit Conrad Lluis-Martell).
-
The Case for Corona Bonds
Anuscheh Farahat unterstützt Matthias Goldmanns Plädoyer für Corona Bonds
-
Brent Spar Revisited?
Kristina Schönfeldts Blogpost auf German Practice in International Law
-
From Constitutional Normality to the State of Emergency
Terea Violante und Rui T. Lanceiros Blogpost über Covid-19 in Portugal
-
Verfassungsrecht und praktische Hoffnung
Anuscheh Farahats Verfassungsblogbeitrag zur Corona-Krise
-
Combatting TINA-Rhetoric through Judicial Review
Anuscheh Farahat und Teresa Violante über Austerität und Verfassungsgerichtsbarkeit
-
(Not)Striking Down Surrogate Motherhood
Teresa Violante über die jüngste Entscheidung des Portugiesischen Verfassungsgerichts
-
Populismus als Platzhalter des demokratischen Versprechens
Marius Hildebrand gemeinsam mit Astrid Séville und Conrad Lluis Martell auf Soziopolis
-
Verfassungsbeschwerde in Portugal?
Teresa Violantes Einschätzung zur möglichen Einführung der Verfassungsbeschwerde in Portugal
-
Pushing for Transformation
Anuscheh Farahat über "Transformative Constitutionalism" auf dem Völkerrechtsblog
-
Entzauberung gescheitert
Marius Hildebrand über die Schweizerische Volkspartei als Avantgarde der Neuen Europäischen Rechten